Aktuelles von den Wanderern
Jahresbericht 2023 der Wanderabteilung
Abteilungsleiter Berndt Wozniak legt Bericht über das Wanderjahr 2023 vor
Bericht des Abteilungsleiters über das Wanderjahr 2023
2023 – Sonntagswanderer und Weitgehclub genießen jeweils 26 Wandertage
Bewegung an frischer Luft tut nicht nur gut, sondern wirkt sich auch positiv auf Stoffwechsel, Kraft und Ausdauer aus. Wandern ist Gesundheitssport, und das konnten wir in unseren Wandergruppen im Jahre 2023 uneingeschränkt genießen.
Die Wanderabteilung hat zum Stichtag 31.12.2023 105 Mitglieder, davon 83 aktiv, 22 inaktiv. 47 Mitglieder wandern beim WGC, 34 bei den Sonntagswanderern und 2 bei den Seniorenwanderern.
„Wandern ist eine Tätigkeit der Beine – und ein Zustand der Seele“, sagt der Philosoph Josef Hofmiller
Schauen wir auf das Wanderjahr 2023, blicken wir auf geplante 52 Wanderungen zurück. Ohne Einschränkungen konnten alle Wanderungen durchgeführt werden. Auch in diesem Jahr spielte das Wetter wieder einmal hervorragend mit. Wir hatten viel Sonnenschein und wenig Niederschlag bei unseren Touren.
Sonntagswanderer
Wie in den vergangenen Jahren auch, trafen sich die Sonntagswanderer auf dem OTB Parkplatz am Haarenufer zu ihren Wanderungen in die Umgebung. Regelmäßig nahmen 15 bis 30 Wanderer an den Wanderungen teil. Im Wanderjahr 2023 wurden alle geplanten Wanderungen durchgeführt. Es kümmerten sich wechselnde Wanderinnen und Wanderer aus der Gruppe um die Organisation der Wandertouren.
Die Wanderreise, die traditionell von der Sonntagswandergruppe organisiert wird, sollte in diesem Jahr an den Niederrhein nach Kleve führen. Bettina von Alten und Heiko Dinklage hatten ein schönes Hotel und ein anspruchsvolles Rahmenprogramm vorbereitet, doch die nötige Anzahl von Anmeldungen konnte nicht erreicht werden. So musste die Reise leider abgesagt werden. Es bleibt zu hoffen, dass im Jahr 2024 die 48. Reise durchgeführt werden kann.
Die traditionelle „Kleine Kulturwanderung“ war in diesem Jahr eine Wanderung durch den Stadtteil Donnerschwee. Hans-Martin Schutte glänzte mit detaillierten Orts- und Entwicklungskenntnissen, Elfriede Mohrmann glänzte mit einem Fachvortrag über Kaffee. Bei einem Mittagessen in der neuen Jugendherberge konnten sich die Teilnehmer von der Qualität der Herbergsküche überzeugen.
Verpflegung / Eintopfessen bei den Wanderungen
Für das traditionelle mittägliche Eintopfessen in den Zielgasthöfen sorgte wieder mit großem Einsatz Gerda Salomon, der an dieser Stelle besonders gedankt wird.
Seniorenwandergruppe
Die Seniorenwandergruppe ist alters- und gesundheitsbedingt stark geschrumpft. Lediglich Peter Holl und Dieter Mielenz treffen sich noch regelmäßig zu kurzen Wanderungen in die Umgebung.
Weitgehclub (WGC)
Der nunmehr seit 75 Jahren bestehende Weitgehclub (WGC) wollte im Jahr 26 Wanderungen durchführen. Auch der WGC konnte zu allen geplanten Wanderungen starten. Der Chronik nach waren es die Wanderungen 1.858 bis 1.883. Jeden zweiten Dienstag wurde im Umkreis von Oldenburg gewandert – die Langlöper um 8.00 Uhr, die Middelpetter um 9.00 Uhr und die Kurztreter um 9.30 Uhr. Treffpunkt war immer eine Gaststätte/ein Restaurant. Von dort ging es dann unter der Leitung der jeweiligen Wanderführer auf einen Rundwanderkurs von 18 km/15 km/10 bzw. 5 km. Um 12.30 Uhr trafen sich die Gruppen wieder zum gemeinsamen Mittagessen.. Allerdings gab es doch kleine Anpassungen im Wanderplan. Das lag vor allem an der Gastronomie, die uns z:T. nicht aufnehmen konnte oder wollte oder einen unangemessenen Essenspreis verlangte. Am Ende haben wir aber immer einen Platz für uns gefunden.
Wie gewohnt sorgte Heiko Dinklage dafür, dass wir unseren erwanderten Appetit mit kleinen Gerichten und leckeren Desserts decken konnten.
Für die Wiederaufnahme der seit der Pandemie eingestellten Nachmittagswanderungen fand sich keine Bereitschaft.
Am 9. Mai gab es eine Wiedergeburt der „Kleinen Kulturwanderung“, die Corona bedingt in den letzten drei Jahren nicht stattfinden konnte. Unser Wanderbruder Dr. Lutz Albers hat eine sehr interessante Tour nach Emden und Leer organisiert. Zunächst ging es nach Emden, wo wir die Johannes a Lasco – Bibliothek besuchten. Bei einem Vortrag durch den wissenschaftlichen Leiter erhielten wir einen Einblick in die Geschichte und die Aufgabenstellung der Bibliothek. Nach einem Mittagessen im Hafenhaus ging es weiter nach Leer. Lutz hat seine Kontakte zum Verein „Prinz Heinrich“ spielen lassen und wir wurden auf dem Dampfschiff, das 1909 auf der Meyer-Werft gebaut wurde, empfangen. An dieser Stelle noch einmal einen besonderen Dank an unseren Lutz.
Ich habe in den OTB-Mitteilungen Nr. 3/2023 einen ausführlichen Bericht veröffentlicht.
Ein besonderes Highlight im Wanderjahr hätte unsere Wanderreise nach Masuren werden sollen, die unser Wanderbruder Dr.Siegmund Fröhlich organisieren wollte. Der Vorlauf war jedoch zu kurz, sodass die Reise mangels ausreichender Beteiligung nicht stattfinden konnte. Unserem Sigi an dieser Stelle noch einmal ein herzlicher Dank für den Impuls..
Schön war es zu erleben, dass wir mit der Weserinsel „Harriersand“ ein neues Wandergebiet erschlossen haben. Mit der Fähre „Gunt Sieht“ ging es von Brake aus bei Frühnebel über die Weser. Die Tide tat uns den Gefallen und ließ ein Wandern am Strand zu. Mit zunehmender Flut mussten wir dann aber auf den Deichweg und die Inselstraße ausweichen und konnten von dort die Schönheiten der Insel erleben. Ein schmackhaftes Matjesessen in der Strandhalle Harriersand rundete eine tolle Wanderung ab, die bei strahlendem Sonnenschein mit der Rückfahrt auf der Fähre nach Brake endete. Die Resonanz auf diesen Versuch war durchweg positiv.
Die Generalversammlung des WGC fand traditionsgemäß am 31. Januar im Gasthaus Brüers in Munderloh statt. Nach einem gemeinsamen Grünkohlessen wurde vom Vortreter Berndt Wozniak der Jahresbericht verlesen, Michael Börgmann stellte launig die Jahreswanderergebnisse vor, Jochen Künkel erstattete seinen Finanzbericht. Neuer Kohlkönig wurde Dr. Lutz Albers, der aus den Händen seines Vorgängers Jochen Schuler die Königskette übernahm. Als Wanderer des Jahres wurden unsere Senioren Heyko Buss, Klaus Rother und Gerhard Wolf geehrt.
Mit Wanderliedergesang, begleitet von Jochen Schuler an der Gitarre, endete diese Versammlung, die nach zweijähriger Coronapause endlich wieder stattfinden konnte.
Traditionskohlfahrt
Die Traditionskohlfahrt des OTB, die Anfang Februar zum 152. Mal stattfand, führte vom OTB-.Clubhaus Diekerts am Osterkampsweg in Richtung Wildenloh. Der noch amtierende Kohlkönig und Wanderbruder Berndt Wozniak hatte eine 6 km Rundwanderung organisiert, die mit Boule- Spielen aufgelockert und mit kleinen Snacks und Getränken angereichert war. Die Königswürde gaben Berndt Wozniak und Katja Leinau an das neue Königspaar Silke Wemken und Michael Reinhold ab.
Wanderliedersingen
30 Jahre Jahre hat Helga Dalenbrok mit den Wanderern gesungen und die Gruppe mit ihrer Gitarre begleitet. Am 31.12. hat Helga nun altersbedingt die Leitung abgegeben. Sie hat mit ihrer heiteren Ausstrahlung immer für gute Stimmung gesorgt. Mit Ablauf des Jahres übernimmt unser Wanderfreund Michael Fritsche die Leitung der Sangesgruppe.
Helga Dalenbrok wurde in einer kleinen Feierstunde am 4.12. als Leiterein der Sängergruppe verbschiedet. Der Geschäftsführer des OTB, Frank Kuhnert, ließ es sich nicht nehmen,Helga persönlich zu danken. Als Nikolaus verkleidet trat unser zweiter Vorsitzender Jochen Steffen auf, im Rucksack hatte er u.a. die „Goldene Ehrennadel“ des Vereins, die er Helga überreichte.
Ehrungen
Besondere Ehrungen erfolgten
Im Rahmen der am 24. Juni durchgeführten Veranstaltung des Vorstandes:
80 Jahre Mitgliedschaft: Hans-Jürgen Eßer, Hille Schutte
55 Jahre Mitgliedschaft: Hans-Martin Schutte
25 Jahre Mitgliedschaft: Klas Krüger
Innerhalb der Wanderabteilung
Klas Krüger für 11.000 km
Heiko Dinklage für 9000 km
Herbert Mesch für 5000 km,
Gregor Angelis, Werner Papenhausen Rolf Schiborowski, Hans-Martin Schutte, Klaus Wegling für 1000 km.
Hier noch einmal ein herzlicher Glückwunsch an die Jubilare und die Wanderer für die erbrachten Leistungen.
Erwähnenswert sind folgende runde Geburtstage, die Mitglieder unserer Wanderabteilung im vergangenen Wanderjahr vollendet haben:
80 Jahre: Dagmar Büsing, Sigrid Frenzel, Edzard Grotelüschen,
90 Jahre: Hermann Banemann, Hajo Gerdes, Klaus Rother, Kurt Müller-Meinhard
Besonders hervorheben möchte ich auch in diesem Jahr alle WanderInnen, die im vergangenen Jahr älter als 90 Jahre wurden:
Monika Hemmen (91), Edith Niemann (93)
100 Jahre alt wurde Hans Hemmen. Antje Neumann aus der Geschäftsführung und Berndt Wozniak überbrachten dem Jubilar Nicht nur die Glückwünsche, sondern auch ein angemessenes Angebinde mit gesunden Lebensmitteln aus dem Reformhaus.
Unsere herzlichen Glückwünsche zur Vollendung dieser hohen Geburtstage.
Zu unserem Leben - auch zu einem Wanderleben - gehören Abschiede!
Wir Wanderer haben auch im vergangenen Jahr langjährige Wanderfreunde verloren!
Zusammen mit den Angehörigen betrauern wir den Tod von
Wilhelm Heinzelmann im Alter von 75 Jahren am 13.05.
Edzard Hüttmann im Alter von 85 Jahren am 24.12.
Viele aus unserem Kreis erinnern sich an die gemeinsamen Wanderungen mit den Verstorbenen und werden sie in guter Erinnerung behalten.
Alle Aktivitäten der Wandergruppen ließen sich nur durchführen, weil engagierte Mitglieder der Abteilung sich eingesetzt und so die große Vielfalt an Veranstaltungen möglich gemacht haben.
Zu Schluss möchte ich in besonderem Maße Dank sagen
den Organisatoren der Sonntagswandergruppe, Gerda Salomon, Irmgard Mohrmann Anne Dobrat, Heiko Dinklage
dem Vortreter des Weitgehclubs, Berndt Wozniak
Durch eure selbständige Arbeit in Euren Gruppen habt ihr meine Arbeit als Abteilungsleiter sehr leicht gemacht. Dafür ein herzliches „Dankeschön“!
Zugleich möchte ich es aber nicht versäumen, auch den Wanderführerinnen und Wanderführern sowie allen, die sich in der Wanderabteilung aktiv durch Übernahme von Sonderaufgaben betätigt haben, sei es durch das Schreiben von Protokollen, Beiträgen und Berichten, das Fortführen der Chronik des WGC, das Pflegen des Internetauftrittes und unseres Archivs, das Absprechen der Mittagsmahlzeiten mit den Lokalbetreibern, das Vortragen von Geschichten und Gedichten, beim Singen im Winterhalbjahr sowie den Besuch bei erkrankten oder zu ehrenden Wanderinnen und Wanderern unserer Abteilung ganz besonders zu danken.
All diesen fleißigen Helfern ist bewusst, dass unser OTB kein Dienstleistungsbetrieb ist, sondern ein Sportverein, in dem ein kameradschaftliches und helfendes Miteinander zum Gelingen einer jeden Wanderung oder anderer Veranstaltungen selbstverständlich ist.
Berndt Wozniak
Jahresbericht Wandern 2022
2022 – Wieder einmal Wandern ohne Corona-Einschränkungen
Bewegung an frischer Luft tut nicht nur gut, sondern wirkt sich auch positiv auf Stoffwechsel, Kraft und Ausdauer aus. Wandern ist Gesundheitssport, und gerade nach den Einschränkungen der Pandemie ist wandern wieder uneingeschränkt in unseren Wandergruppen möglich gewesen.
Die Wanderabteilung hat zum Stichtag 31.12.2022 107 Mitglieder, davon 84 aktiv, 23 inaktiv. 48 Mitglieder wandern beim WGC, 34 bei den Sonntagswanderern und 2 bei den Seniorenwanderern.
„Wandern ist eine Tätigkeit der Beine – und ein Zustand der Seele“, sagt der Philosoph Josef Hofmiller
Schauen wir auf das Wanderjahr 2022, blicken wir auf geplante 52 Wanderungen (ohne Seniorenwandergruppe) zurück. Ohne Einschränkungen durch Lockdowns konnten alle Wanderungen durchgeführt werden. Auch in diesem Jahr spielte das Wetter wieder einmal hervorragend mit. Wir hatten viel Sonnenschein und wenig Niederschlag bei unseren Touren.
Sonntagswanderer
Wie in den vergangenen Jahren auch, trafen sich die Sonntagswanderer auf dem OTB Parkplatz am Haarenufer zu ihren Wanderungen in die Umgebung. Regelmäßig nahmen 15 bis 30 Wanderer an den Wanderungen teil. Im Wanderjahr 2022 wurden alle geplanten Wanderungen durchgeführt. Es kümmerten sich wechselnde Wanderinnen und Wanderer aus der Gruppe um die Organisation der Wandertouren.
Gut war auch in diesem Jahr wieder das Interesse an der Wanderreise der Wanderabteilung, die traditionell von der Sonntagswandergruppe organisiert wurde und zum 47. Mal stattfand. Zwanzig WanderfreundInnen nahmen teil. Ein herzlicher Dank für die Vorbereitung und Organisation und Durchführung dieser Fahrt geht an Bettina von Alten und Heiko Dinklage. Die Reise führte diesmal vom 05. – 10. September nach Neustadt-Glewe im schönen Mecklenburg . Die Kleinstadt mit ca. 8000 Einwohnern, eine ehemalige Ackerbürgerstadt, war Standquartier für die Reisegruppe. Die mittelalterliche Burganlage ließ die Gruppe staunen, ist die Anlage doch die Älteste noch erhaltene Wehrburg Mecklenburgs und Wahrzeichen der Stadt. Herrschaftliche Unterkunft war ein ehemaliges Schloss, das nach der Wende aufwendig renoviert wurde. Von hier aus erkundete die Gruppe per Bus und Bahn die verschiedenen Gebiete der Region.
Natürlich wurde viel gewandert. Beispielhaft sei die Wanderung auf dem Rundweg um den wunderschönen Wockersee bei Parchim genannt.
Auch die Kultur kam nicht zu kurz. Schloss Ludwigslust, das Jagdschloss aus dem 17. Jahrhundert, nach französichem Vorbild ausgebaut, das Hagenower Museum für Alltagskultur, wurden jeweils aufgesucht und kompetente Führer machten vertraut mit der geschichtlichen Entwicklung und den damaligen Lebensverhältnissen.
Ein ausführlicher Bericht von Eva-Maria Fischer ist in OTB-Mitteilungen Nr.4/2022 erschienen.
Nach zweijähriger Corona bedingter Pause starteten auch endlich wieder 38 Sonntagswanderer am 8. Mai 2022 zu einer „Kulturwanderung“, die von Anne Dobrat und Heiko Dinklage sehr gut vorbereitet und durchgeführt wurde. Mit dem Bus wurde die Krummhörn erkundet, gelegen im Nordwesten Ostfrieslands, wo sie die Stadt Emden westlich bis nördlich umrahmt, aber dennoch zur Gemeinde Aurich gehört. Sie liegt teilweise mehr als 2 m unter dem Meeresspiegel und wird von ca. 13.000 Einwohnern besiedelt, die in 19 kleinen Ortschaften leben.
Schönstes Frühlingswetter verwöhnte den ganzen Tag über und ließ in der Landschaft das satte Grün der Wiesen, das Gelb vieler blühender Rapsfelder und das Blau des Himmels besonders strahlen.
Auch hier verweise ich auf den ausführlichen Bericht von Eva-Maria Fischer (OTB-Mitteilungen 2/2022).
Für das traditionelle mittägliche Eintopfessen in den Zielgasthöfen sorgte wieder Gerda Salomon, der an dieser Stelle besonders gedankt wird.
Seniorenwandergruppe
Die Seniorenwandergruppe ist alters- und gesundheitsbedingt stark geschrumpft. Lediglich Peter Holl und Dieter Mielenz treffen sich noch regelmäßig zu kurzen Wanderungen in die Umgebung.
Weitgehclub (WGC)
Der nunmehr seit 74 Jahren bestehende Weitgehclub (WGC) wollte im Jahr 26 Wanderungen durchführen. Auch der WGC konnte zu allen geplanten Wanderungen starten. Der Chronik nach waren es die Wanderungen 1.832 bis 1.857. Jeden zweiten Dienstag wurde im Umkreis von Oldenburg gewandert – die Langlöper um 8.00 Uhr, die Middelpetter um 9.00 Uhr und die Kurztreter um 9.30 Uhr. Treffpunkt war immer eine Gaststätte/ein Restaurant. Von dort ging es dann unter der Leitung der jeweiligen Wanderführer auf einen Rundwanderkurs von 20 km/15 km/10 bzw. 5 km. Um 12.30 Uhr trafen sich die Gruppen wieder zum gemeinsamen Mittagessen.. Da einige Gasthöfe/Restaurants wegen Personalknappheit nicht für uns öffnen wollten oder konnten, mussten wir den Wanderplan mehrfach anpassen. Am Ende haben wir aber immer einen Platz für uns gefunden.
Wie gewohnt sorgte Heiko Dinklage dafür, dass wir unseren erwanderten Appetit mit kleinen Gerichten und leckeren Desserts decken konnten.
Auf die Nachmittagswanderungen für einige Unentwegte haben wir in diesem Jahr verzichtet.
Die „Kleine Kulturwanderung“, die uns unter Leitung von Folker von Hagen zur Uni Vechta und zur dortigen evangelischen Kirche, die zugleich Kirche des Frauengefängnisses ist, führen sollte, mussten wir leider noch einmal absagen.
Höhepunkt des Wanderjahres war sicher die gemeinsame Wanderreise nach Breslau. Vom 1. bis 05. Juli war die niederschlesische Metropole das Ziel von 26 Wanderern. Unser Wanderbruder Siegmund Fröhlich hat diese Reise in das wegen ihrer mehr als 120 Brücken auch als „Venedig des Ostens“ genannte Zentrum im Westen Polens akribisch vorbereitet und mit Herzblut durchgeführt. Ihm gilt unser besonderer Dank.
Diese Stadt zog uns sofort in ihren Bann, was vielleicht an der Mischung aus polnischer, deutscher, böhmischer und habsburgischer Vergangenheit gelegen hat. Alle Facetten der Architektur treffen hier aufeinander – vom gotischen Prachtbau bis zum sozialistischen Monumentalbau. Heute gilt Breslau als eine der schönsten Städte Polens. Begeistert hat uns der historische Marktplatz, die lebendige Markthalle, die Bürgerhäuser am Salzmarkt, in der Universität die großartig restaurierte Aula Leopoldina. Ein weiterer Höhepunkt war der Empfang durch das Direktorium der technischen Universität. Hier hat unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel u.a. ihre Ehrendoktorwürde erhalten.
Berndt Wozniak hat in den OTB-Mitteilungen Nr. 3/2022 einen ausführlichen Reisebericht veröffentlicht. Auf diesen Bericht verweise ich für weitere Details dieser eindrucksvollen Wanderreise.
Die Generalversammlung, die traditionsgemäß immer im Januar im Gasthaus Brüers in Munderloh stattfindet und die mit einem gemeinsamen Grünkohlessen ausklingt, wurde wegen einer in Oldenburg herrschenden Corona-Infektionswelle sicherheitshalber abgesagt. Die Wanderer erhielten den Jahresbericht, die Wanderchroniken, die Wanderstatistiken und den Kassenbericht per „Post“.
Der amtierende Kohlkönig Jochen I. Schuler behält seine Königswürde daher ein weiteres Jahr.
Traditionskohlfahrt:
Die Traditionskohlfahrt des OTB, die Ende Januar zum 151. Mal stattfinden sollte, fiel aus den vorgenannten Gründen ebenfalls aus.. Unser Wanderbruder Berndt Wozniak bleibt daher ebenfalls ein weiteres Jahr Kohlkönig, genau wie die amtierende Königin Katja Leinau aus der Tanzabteilung.
Ehrungen
Innerhalb der Wanderabteilung wurden besonders geehrt:
Hermann Klasen, Heinrich Meiners, Jochen Schuler für 5000 km,
Jochen Künkel für 3000 km,
Lutz Albers, Ingo Deelwater, Rolf Giele. Günter Janssen für 2000 km.
Hier noch einmal ein herzlicher Glückwunsch für diese Wanderleistung.
Erwähnenswert sind folgende runde Geburtstage, die Mitglieder unserer Wanderabteilung im vergangenen Wanderjahr vollendet haben:
80 Jahre: Elfriede Coburger, Antje Grotelüschen, Clemens Meyer, Folker von Hagen, Michael Huppke
90 Jahre: Monika Hemmen, Heyko Buss
Besonders hervorheben möchte ich auch in diesem Jahr alle WanderInnen, die im vergangenen Jahr älter als 90 Jahre wurden:
Rudolf Dohrmann (98), Hans Hemmen (99), Annemarie Krull (97),
Unsere herzlichen Glückwünsche zur Vollendung dieser hohen Geburtstage.
Zu unserem Leben - auch zu einem Wanderleben - gehören Abschiede!
Wir Wanderer haben auch im vergangenen Jahr langjährige Wanderfreunde verloren!
Zusammen mit den Angehörigen betrauern wir den Tod von
Dr. Johann Vollmers im Alter von 90 Jahren am 02.03.2022
Hermann Rudolph im Alter von 96 Jahren am 05.07.2022
Karl - Jürgen Sporkert im Alter von 92 Jahren am 04.12.2022
Prof. Dieter Finck im Alter von 83 Jahren am 29.12.2022
Viele aus unserem Kreis erinnern sich an die gemeinsamen Wanderungen mit den Verstorbenen und werden sie in guter Erinnerung behalten.
Alle Aktivitäten der Wandergruppen ließen sich nur durchführen, weil engagierte Mitglieder der Abteilung sich eingesetzt und so die große Vielfalt an Veranstaltungen möglich gemacht haben.
Zu Schluss möchte ich in besonderem Maße Dank sagen
den Organisatoren der Sonntagswandergruppe, Gerda Salomon, Irmgard Mohrmann Anne Dobrat, Klas Krüger, Heiko Dinklage
dem Vortreter des Weitgehclubs, Berndt Wozniak
Durch Eure selbständige Arbeit in Euren Gruppen habt Ihr meine Arbeit als Abteilungsleiter sehr leicht gemacht. Dafür ein herzliches „Dankeschön“!
Zugleich möchte ich es aber nicht versäumen, auch den Wanderführerinnen und Wanderführern sowie allen, die sich in der Wanderabteilung aktiv durch Übernahme von Sonderaufgaben betätigt haben, sei es durch das Schreiben von Protokollen, Beiträgen und Berichten, das Fortführen der Chronik des WGC, das Pflegen des Internetauftrittes und unseres Archivs, das Absprechen der Mittagsmahlzeiten mit den Lokalbetreibern, das Vortragen von Geschichten und Gedichten, beim Singen im Winterhalbjahr sowie den Besuch bei erkrankten oder zu ehrenden Wanderinnen und Wanderern unserer Abteilung ganz besonders zu danken.
All diesen fleißigen Helfern ist bewusst, dass unser OTB kein Dienstleistungsbetrieb ist, sondern ein Sportverein, in dem ein kameradschaftliches und helfendes Miteinander zum Gelingen einer jeden Wanderung oder anderer Veranstaltungen selbstverständlich ist.
Berndt Wozniak, Abteilungsleiter Wandern
Wieder unterwegs: Sonntagswanderer auf Erkundungstour in Ostfriesland
Kulturwanderung führt in die Krummhörn

Nach zweijähriger coronabedingter Pause starteten endlich wieder 38 Sonntagswanderer am 8. Mai 2022 zu einer „Kulturwanderung“, die von Anne Dobrat und Heiko Dinklage sehr gut vorbereitet und durchgeführt wurde. Mit dem Bus erkundeten wir die Krummhörn, gelegen im Nordwesten Ostfrieslands, wo sie die Stadt Emden westlich bis nördlich umrahmt, aber dennoch zur Gemeinde Aurich gehört. Sie liegt teilweise mehr als 2 m unter dem Meeres-spiegel und wird von ca. 13.000 Einwohnern besiedelt, die in 19 kleinen Ortschaften leben. Frühlingswetter verwöhnte uns den ganzen Tag über. Farblich dominierten in der Landschaft das satte Grün der Wiesen, das Gelb vieler blühender Rapsfelder und das Blau des Himmels.
Zunächst besichtigten bei in einer Führung die Kirche in Suurhusen, erbaut im 13. Jahrhundert. Deren Turm weist eine größere Neigung (Neigungswinkel 5,07°) auf als der bekannte Schiefe Turm von Pisa (3,9°). Der Grund für das Absacken des Turmes war sein Anbau erst gut 200 Jahre später auf dem weniger befestigten Boden. Erst nach mehreren Sicherungsversuchen des Turmes in den 80er und 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist die Neigung zum Stillstand gekommen. So konnte die Kirche, nachdem sie zeitweise „aufgegeben“ worden war, nach der Sanierung wieder für die Gemeinde geöffnet werden. Hingewiesen wurden wir auf einen eingemauerten hellen Sandstein, der die Höhe einer Flut aus dem Jahr 1570 in einer Höhe von 4,40 m über NN markiert!
Nach einem schmackhaften Mittagessen in der Alten Brauerei in Pilsum unternahmen wir mit unserem Bus eine dreistündige Rundfahrt durch eine Vielzahl dieser kleinen Ortschaften und erfuhren von einer kompetenten Gästeführerin viel Wissenswertes über die Geschichte der Krummhörn, den Aufbau der Dörfer, über den Deichbau und Hochwasserschutz. Da die Menschen mehrfach dem Meer Land abgerungen haben, muss ständig durch Siele und Schöpfwerke entwässert werden, da große Landflächen – wie schon erwähnt – unter dem Meeresspiegel liegen. Das gewonnene Land, das sog. Polderland, ist sehr fruchtbar und somit für Weizenanbau geeignet ist, während ansonsten viel Viehwirtschaft betrieben wird.
Besiedelt wurde das Land früher in Runddörfern, die zum Hochwasserschutz in der Regel auf einer Warft errichtet wurden mit der Kirche auf dem höchsten Punkt in der Mitte des Ortes, wobei der Kirchturm auch oft als Schutzturm diente. Die Häuser gruppierten sich in zwei konzentrischen Kreisen um die Kirche. Im äußeren Ring standen die Bauernhäuser, vielfach große Gulfhäuser, deren Hofeinfahrt für Ernte und Vieh nach hinten zu den Feldern und Wiesen lag. Die Wohnhäuser der Kleinsiedler und Arbeiter befanden sich im inneren Ring. - In jedem Dorf, das wir passierten, sahen wir eine alte Kirche, vorwiegend sind es evangelisch-reformierte Kirchen, also reine Predigtkirchen ohne Schmuck. Die Ziegelsteine dieser alten Kirchen enthielten vielfach als Beimischung Muschelkalk und das Mauerwerk wurde oft mit Muschelkalk verfugt, der elastisch ist und Bodenschwankungen auf diesem instabilen Untergrund aushalten kann. Dadurch sind viele der alten Kirchen erhalten geblieben. Einige Windmühlen waren ebenso zu sehen wie ab und an erhaltene alte Häuptlingsburgen, die heute - wie auch die Windmühlen - meist als Museum dienen.
Mehrfach verließen wir den Bus und besichtigten z. B. das schönste und besterhaltene Runddorf „Rysum“ und die dortige Kirche; wir sahen den höchsten Leuchtturm Deutschlands in Campen, erbaut 1890, mit einer Höhe von 63,5 m aus der Nähe, und wir ließen an der Knock, der südwestlichsten Landecke der Krummhörn, den Blick über die Emsmündung hinüber nach Holland schweifen und uns dabei eine frische Brise um die Ohren wehen.
Die Krummhörn lebt stark vom Tourismus, was wir nach unserer Rundfahrt bei einem Spaziergang durch Greetsiel beobachten konnten. Auch an unserem Ausflugstag, einem Sonntag, waren zahlreiche Geschäfte geöffnet, es herrschte in den Straßen reges Treiben, die große Krabbenkutterflotte lag wegen der Sonntagsruhe geradezu malerisch im Hafen, der seit 30 Jahren durch eine Schleuse tideunabhängig ist. Greetsiel ist jetzt der bekannteste Ort der Krummhörn, seit sich in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts Künstler dort ansiedelten. Mehr als 60 % der Wohnungen sind allerdings Fremdeigentum.
Manch einer von uns hatte in Greetsiel Mühe, einen Sitzplatz in einem Café zu finden, um sich für die Rückfahrt mit Tee/Kaffee und Kuchen zu stärken. Alle Teilnehmer waren mit diesem wunderschönen Tag sehr zufrieden und so danken wir auch auf diesem Wege nochmals herzlich Anne und Heiko für die Idee und die Organisation dieser gelungenen Kulturwanderung Eva-Maria Fischer
Wanderstrecken in und um Oldenburg
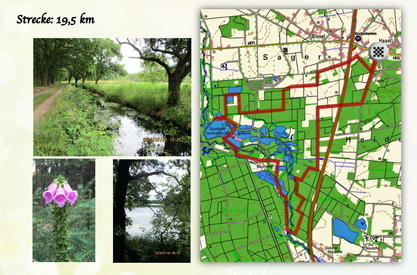
In Zeiten von Corona, stellt die Wanderabteilung des OTB untenstehende Wanderstrecken zum Download bereit.
Wanderabteilung zieht Bilanz des Wanderjahres 2018
Berndt Wozniak legt Bericht über das Wanderjahr vor
Wandern und Wohlfühlen
Wandern, das ist weder Sonntagsspaziergang noch „Streckemachen“, sondern die wohltuende Mischung aus Fitness, Entspannung, Naturerlebnis und Geselligkeit – kurz: ein ganzheitliches kombiniertes Fitness- und Wellnessprogramm.
In der Medizin hat der Gehsport mittlerweile einen neuen Stellenwert erhalten. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die schonende, aber konsequente Bewegung Beschwerden lindert und Krankheitsrisiken senkt. Statt aggressivem Auspowern empfehlen Ärzte zunehmend Wandern als Königsdisziplin zum Erlangen stressfreier Fitness.
Wandern ist also Gesundheitssport.
Die Wanderabteilung hat zum Stichtag 31.12.2018 116 Mitglieder, davon 97 aktiv, 19 inaktiv. 47 Mitglieder wandern beim WGC, 55 bei den Sonntagswanderern und 11 bei den Seniorenwanderern.
Schauen wir uns das Wanderjahr 2018 an, gibt es nur ein Fazit: wir hatten ein Traumwanderjahr, Regenschirm und Regenjacken blieben in diesem Jahr in der Versenkung.
Sonntagswanderer
Wie in den vergangenen Jahren auch, trafen sich die Sonntagswanderer auf dem OTB Parkplatz am Haarenufer zu ihren Wanderungen in die Umgebung. Regelmäßig nahmen 25 bis 35 Wanderer an den Wanderungen teil. Im Wanderjahr 2018 wurden insgesamt 26 Wanderungen durchgeführt.
Zufriedenstellend war auch in diesem Jahr wieder das Interesse an der Wanderfahrt der Wanderabteilung im August, die traditionell von der Sonntagswandergruppe organisiert wurde und zum 43. Mal stattfand. Dreißig WanderfreundInnen nahmen teil. Ein herzlicher Dank für die Vorbereitung und Organisation dieser Fahrt geht an Bettina von Alten, Anne Dobrat, Klas Krüger, Matthias Schachtschneider und Hans-Martin Schutte. Die Reise führte diesmal vom 25. – 31.08. in die Saale-Unstrut-Region, eine Gegend, wo die Geschichte allgegenwärtig ist und Burgen, Schlösser und Kirchen beliebte Wanderziele sind. Die Wanderungen vor Ort führten u.a. zum Fuchsturm auf dem Hausberg Jenas, ferner wurde entlang der Saale in das Gebiet von Neuengönna und Postendorf gewandert. Eine kulturhistorisch ebenso schöne Wanderung führte entlang von Saale und Unstrut und durch den Blütengrund von Henne bei Naumburg nach Freyburg. Außerdem wurden entlang der kleinen Saale die Burgen Saaleck und Rudelsburg erkundet. Abendliche Vorträge sowie Fachreferate rundeten das jeweilige Tagesprogramm ab. Über die interessante, sehr gut organisierte Fahrt wurde schon im letzten OTB-Mitteilungsblatt (03/2018) berichtet.
Auch im nächsten Jahr soll wieder eine Wanderfahrt stattfinden. Bettina von Alten mit einem kleinen Organisationsteam hat sich wiederum angeboten, die Vorbereitung und Organisation dafür zu übernehmen. Es soll im September 2019 nach Hannoversch-Münden gehen.
Die Kulturwanderung der Sonntagswanderer führte bei schönstem Sommerwetter am 27. Mai 2018 nach Butjadingen, dem nördlichsten Teil der Wesermarsch. Es wurde über die Entstehungsgeschichte informiert, das Landschaftsbild mit Sielen und Entwässerungsgräben betrachtet, die Wurten und Höfe bewundert. Der Verbandsvorsteher des II. Oldenburgischen Deichbands berichtete über seine Arbeit und aktuelle Probleme des Hochwasserschutzes, über die Ausbreitung der Bisamratten sowie Probleme der Deichschäferei mit dem Wolf. Höhepunkt der Fahrt war die Besichtigung zweier Kirchen mit Orgeln der Orgelbaufamilie Schmidt aus dem 19. Jahrhundert in Waddens und Schwei. Die Orgelsachverständige der evangelisch-lutherischen Landeskirche begeisterte dann zum Abschluss noch mit einem brillianten Orgelspiel. Anne Dobrat und Hans-Martin Schutte hatten diese Fahrt vorbereitet und organisiert.
Der neue Wanderplan für 2019 ist von den Wanderfreunden Anne Dobrat und Dieter Mielenz zusammengestellt worden. Für das traditionelle mittägliche Eintopfessen in den Zielgasthöfen ist künftig Gerda Salomon zuständig. Anne Meyer sei an dieser Stelle gedankt für die perfekte Organisation in den vergangenen Jahren.
Im Winterhalbjahr (von Oktober bis April) fand – wie in den Vorjahren auch – das beliebte Wanderliedersingen statt. Helga Dalenbrok gilt dafür ein besonderer Dank.
Seniorenwandergruppe
Die Organisation der Seniorengruppe erfolgte – wie in den Vorjahren - durch Peter Holl und Hajo Gerdes. Die noch Aktiven der Seniorengruppe wurden regelmäßig durch drei bis vier WGC – Wanderer ergänzt. Die Gruppe trifft sich weiterhin dienstags um 14 Uhr, um einen gemeinsamen Spaziergang zu unternehmen. Dieser führt durch das Eversten Holz oder den Schlossgarten. Gerne angenommen wird aber von den Mitgliedern der Gruppe, denen selbst diese kurzen Spaziergänge zu weit sind, die gemeinsame Kaffeetafel, die im Cafe Janssen oder im Cafe Klinge stattfindet. Hier treffen sich die Mitglieder in geselliger Runde zu anregenden Gesprächen. Erfreut sind die Seniorenwanderer, dass es für das Cafe Janssen im neuen Jahr einen neuen Pächter geben wird, der dieses nah am Eversten Holz liegende Cafe weiterführen wird.
Weitgehclub (WGC)
Am 16. November 2018 bestand der Weitgehclub (WGC) 70 Jahre. Begonnen hatte alles in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg: Karl und Wilhelm Sandstede starteten mit wenigen Gleichgesinnten am 16.11.1948 zu Wanderungen in die nähere Umgebung Oldenburgs. Mit dem Bus oder der Bahn ging es nach Hude, Bad Zwischenahn oder Rastede. Von dort wurde dann der Rückweg angetreten. Das in der Regel nicht auf dem kürzesten Weg, sondern gewandert wurde durch landschaftlich schöne Gegenden. Am späten Nachmittag kehrte man dann nach Oldenburg zurück. Damit war der Weitgehclub (WGC) entstanden. Jede Wanderung wurde protokolliert, Erlebnisse schriftlich fixiert, in Ermangelung von Fotoapparaten schöne Aussichten oder Sehenswürdigkeiten in kleinen Zeichnungen festgehalten
Im November 2018 – zum Jubiläum - wurde bereits die 1.773. Wanderung durchgeführt. In der Tradition von Karl und Wilhelm Sandstede wird immer noch jede Wanderung protokolliert, die Wanderstrecke exakt festgehalten. Bilder von jeder Wanderung – heute allerdings mit dem Fotoapparat oder dem Handy geschossen - erinnern in der Chronik an das Erlebte.
Auch im vergangenen Jahr trafen sich in dieser Tradition jeden zweiten Dienstag im Umkreis von Oldenburg – insgesamt 25 mal - die Langlöper um 8.00 Uhr, die Mittelpetter um 9.00 Uhr und die Kurztreter um 9.30 Uhr an einer Gaststätte. Von dort ging es dann unter der Leitung der jeweiligen Wanderführer auf einen Rundwanderkurs von 20 km/15 km/10 bzw. 5 km. Um 12.30 Uhr trafen sich die Gruppen wieder zum gemeinsamen Mittagessen.
Wie gewohnt sorgte Heiko Dinklage dafür, dass wir unseren erwanderten Appetit mit leckeren Gerichten und fantasievollen Desserts decken konnten. Nachmittags ließen einige Unentwegte den Wandertag mit einer kurzen Wanderung von 5 bis 6 km ausklingen.
Die „Kleine Kulturwanderung“, die wieder von Folker von Hagen glänzend organisiert und vorbereitet wurde, führte 28 Wanderer am 07. August in das Artland. Mit dem Bus ging es nach Quakenbrück und danach in das Museumsdorf Cloppenburg. Quakenbrück ist das Herz des Artlandes, einer fruchtbaren Landschaft nördlich von Osnabrück, welche der Eiszeit und der Hase landwirtschaftlich ertragreiche Böden verdankt. Entsprechend wohlhabend waren die Bauern, was sie gerne durch prächtige Hofbauten mit aufwändigem Fachwerk demonstrierten. Zahlreiche dieser Höfe sind heute noch in der Region zu finden – viele aber nicht mehr landwirtschaftlich genutzt – einige sind im Museumsdorf Cloppenburg aufgebaut. Eine Stadtführung in Quakenbrück mit dem größten Marktplatz von Nordwestdeutschland und ein in dieser Region einzigartiges Ensemble von gut erhaltenen Fachwerkhäusern beeindruckte uns. Eindrucksvoll auch die vor über 700 Jahren entstandene Kirche St. Sylvester. Gestärkt haben wir uns mit leckerem Curry-Huhn im Artland-Kotten, herrlich direkt an der Hase gelegen. Nachmittags wurde dann das Museumsdorf Cloppenburg besucht, wo uns ein Volkskundler und Bauhistoriker die im Dorf aufgebaute Wehlburg und den Quatmannshof erklärte. Trotz großer Hitze – es wurden bis zu 36 Grad gemessen – erreichten alle Teilnehmer wohlbehalten wieder den Zielort Oldenburg. Einen besonderen Dank an dieser Stelle noch einmal an den Organisator dieses erkenntnisreichen Ausfluges, Folker von Hagen. Über diese Kulturfahrt hat Hermann Klasen in den OTB-Mitteilungen (03/2018) berichtet.
Kurzweilig war auch der Besuch der Landesbibliothek am 09.Oktober 2018 auf Einladung unseres Wanderbruders Lutz Albers. Wir erlebten eine kleine Ausstellung, die anhand von Buch-Beispielen die einzelnen (zumeist privaten) Sammlungen beschrieb, die im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte in den Besitz der Bibliothek übergegangen sind.
Highlight war zweifellos der Sachsenspiegel, der in einer Panzerglas-Vitrine zu sehen war.
Im Anschluß an den Vortrag von Herrn Dr. Müller, wissenschaftlicher Leiter des Archives, erläuterte uns Lutz Albers die Landkarten, die im Vortragssaal aufgehängt waren. Dabei handelte es sich um eine kleine Auswahl aus der historischen Kartensammlung, die jüngst in den Besitz der Bibliothek übergegangen waren (ca. 16 Exemplare).
Die Generalversammlung – gehalten von unserem Vortreter Dieter Finck – mit dem anschließenden gemeinsamen Grünkohlessen war wieder ein Höhepunkt des Wanderjahres. Unser Vortreter Dieter Finck würdigte einmal mehr die Jahreswanderleistungen in seinem detaillierten Statistikbericht. Der amtierende Kohlkönig Herbert I. (Mesch) hielt eine launige Festrede über die medizinische Wirkung von Grünkohl. Danach überreichte Herbert der I. die Würde an Dieter den V. (Finck). Er hat diese Würde 2018 überzeugend getragen. Für die musikalische Unterhaltung sorgten wieder die drei „Rudijos“ mit Gesang und Gitarrenklängen. Dahinter verbergen sich unsere Wanderbrüder Rudi Falk, Dieter Hundt und Jochen Schuler.
Sonstiges
Traditionskohlfahrt
Die Traditionskohlfahrt des OTB, die am 28.01.2018 zum 148. Mal stattfand, wurde erstmals von der Wanderabteilung organisiert. Über 70 Teilnehmer begaben sich auf unterschiedlich langen Wanderstrecken von 5 – 10 km um Rastede herum bei idealem Kohlwanderwetter zum Kohllokal „Zum Zollhaus“. Neuer Kohlkönig wurde unser Wanderbruder Michael Huppke, der über diese Kohlfahrt auch in den OTB-Mitteilungen 1/2018 ausführlich berichtet hat.
Am 27. 01.2019 findet die 149. Kohlfahrt statt. Es wäre schön, wenn viele Wanderer unseren Kohlkönig Michael begleiten würden. Ausgerichtet wird die diesjährige Kohlfahrt von den Assistentinnen der Turnabteilung.
Ehrungen
Auch in diesem Jahr fanden im Juni die Ehrungen für verdiente Mitglieder durch den Vorstand im Rahmen einer besonderen Feierstunde statt. Unser Wanderbruder Hans-Jürgen Eßer wurde für seine 75 jährige Mitgliedschaft im OTB geehrt.
Auf der Delegiertenversammlung am 29.11.2018 fanden traditionsgemäß die Würdigungen von Mitgliedern für besondere Leistungen durch Überreichung von Leistungsnadeln statt. Die Leistungsnadel in Gold erhielt unser Wanderbruder Matthias Schachtschneider. Er hat nicht nur über zehn Jahre das OTB-Archiv gepflegt, sondern hat sich auch als Autor der OTB-Chronik zum Jubiläumsjahr 2009 sowie einer umfassenden Aufarbeitung der Sportgeschichte der Stadt Oldenburg, die in diesem Jahr veröffentlicht wurde, besonders verdient gemacht.
Lieber Matthias, auch an dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Glückwunsch zu dieser verdienten Ehrung.
Erwähnenswert sind folgende runde Geburtstage, die Mitglieder unserer Wanderabteilung im vergangenen Wanderjahr vollendet haben:
70 Jahre: Rasch, Maria, Jannsen, Günther, Künkel, Jochen
80 Jahre: Asmussen, Marlies, Dobrat, Anne, Hänßler, Ingrid, Hoedke, Hilke, Mielenz,
Ingrid, Schutte, Hille, Siedenburg, Helga, Ames, Kurt, Krüger, Klas
90 Jahre: Hedden, Edith
Besonders hervorheben möchte ich auch in diesem Jahr alle WanderInnen, die in vergangenen Jahr älter als 90 Jahre wurden: Gisela Ahlring (95), Werner Dörfel (95), Rudolf Dohrmann (94), Hans Hemmen (95), Paul Hey (98), Otto Keune (96), Ilse Kristin (96), Annemarie Krull (93), Hermann Rudolph (93), Marga Süykers (93) sowie Anna Bach, die am 22. Mai 2018 ihr 107. Lebensjahr vollendete. Unsere herzlichen Glückwünsche zur Vollendung dieser hohen Geburtstage.
Zu unserem Leben - auch zu einem Wanderleben - gehören Abschiede! Wir Wanderer haben auch im vergangenen Jahr einen langjährigen Wanderfreund verloren! Zusammen mit den Angehörigen betrauern wir den Tod von Walter Schröder, verstorben im Februar 2018 im Alter von 81 Jahren. Er wanderte seit 2004 mit uns Viele aus unserem Kreis erinnern sich an die gemeinsamen Wanderungen mit dem Verstorbenen und werden ihn in guter Erinnerung behalten.
Aus gesundheitlichen Gründen musste sich Armin Zimmermann aus unserer Wanderrunde verabschieden.
Alle Aktivitäten der Wandergruppen ließen sich nur durchführen, weil engagierte Mitglieder der Abteilung sich eingesetzt haben und nur so die große Vielfalt an Veranstaltungen möglich war.<
Zum Schluss möchte ich in besonderem Maße Dank sagen den Leitern der Seniorenwandergruppe, Peter Holl und Hajo Gerdes, der Leiterin der Sonntagswandergruppe, Anne Dobrat und dem Vortreter des Weitgehclubs, Dieter Finck, der nach mehr als 11 Jahren diese Aufgabe nun abgegeben hat. Durch Eure selbständige Arbeit in Euren Gruppen habt Ihr meine Arbeit als Abteilungsleiter sehr leicht gemacht. Dafür ein herzliches „Dankeschön“!
Zugleich möchte ich es aber nicht versäumen, auch den Wanderführerinnen und Wanderführern sowie allen, die sich in der Wanderabteilung aktiv durch Übernahme von Sonderaufgaben betätigt haben, sei es durch das Schreiben von Protokollen, Beiträgen und Berichten, das Fortführen der Chronik des WGC, das Pflegen des Internetauftrittes und unseres Archivs, das Absprechen der Mittagsmahlzeiten mit den Lokalbetreibern, das Vortragen von Geschichten und Gedichten, beim Singen im Winterhalbjahr sowie den Besuch bei erkrankten oder zu ehrenden Wanderinnen und Wanderern unserer Abteilung ganz besonders zu danken.
All diesen fleißigen Helfern ist bewusst, dass unser OTB kein Dienstleistungsbetrieb ist, sondern ein Sportverein, in dem ein kameradschaftliches und helfendes Miteinander zum Gelingen einer jeden Wanderung oder anderen Veranstaltung selbstverständlich ist. Berndt Wozniak
- 1
- 2
